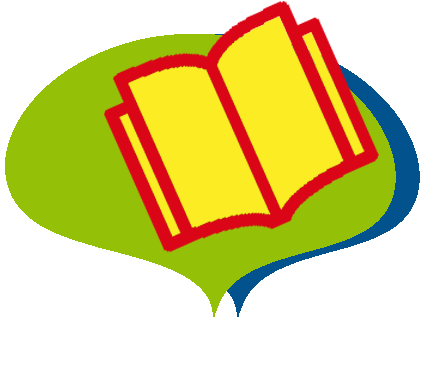
Rahmenrichtlinien zur geschlechterreflektierenden Kinder- und Jugendarbeit mit Jungen* in Bielefeld
Erarbeitet vom Forum Jungen*arbeit Bielefeld
-
1. Gesellschaftliche und gesetzliche Grundlagen
1.1 Gesellschaftliche Grundlage:
Ist Jungen*arbeit als eine Form geschlechterreflektierender Kinder- und Jugendarbeit überhaupt noch zeitgemäß? Eine berechtigte Frage in einer Zeit, in der sich binäre Geschlechterordnung und Heteronormativität im Wandel befinden und junge Menschen deutlich mehr Möglichkeiten haben, sich ihre Zugehörigkeiten selbst zu zuschreiben und individuelle Lebensentwürfe zu gestalten. Pluralität und Diversität werden sowohl mehrheitlich politisch anerkannt und gefördert, als auch medial dargestellt und abgebildet. Vor diesem Hintergrund kann der Eindruck entstehen, alle Individuen seien in der Gestaltung ihrer eigenen Identität völlig frei und selbstbestimmt.
Die Möglichkeiten der gesteigerten Einflussnahme auf die eigene Identität wird aber auch von großen Herausforderungen und Widerständen begleitet. Zum einen geschieht dieser Wandel innerhalb einer Gesellschaft, die in ihren Grundzügen nach wie vor zweigeschlechtlich konstruiert und heteronormativ geprägt ist und in der es auch vielfältig motivierte (z.B. politisch, religiöse) Formen des Widerstandes gegen die Veränderung gibt. Vielen jungen Menschen fehlen nach wie vor die Zugänge zu Individualität und Diversität. Zum anderen suchen viele junge Menschen in dieser sich verändernden Gesellschaft nach Orientierung und Unterstützung bei der zentralen Entwicklungsaufgabe ihrer Identitätsentwicklung.
Vor diesem Hintergrund und den Erfahrungen aus der Praxis erübrigt sich die Frage nach der Relevanz der Jungen*arbeit. Der Bedarf der Jungen* und jungen Männern* nach einem geschlechterreflektierenden pädagogischen Angebot ist nach wie vor gegeben. Die Anforderungen an ein solches Angebot haben sich allerdings in den vergangenen Jahren verändert und weiterentwickelt. So entscheidet nicht mehr die pädagogische Fachkraft anhand rein biologischer Kategorien, wer an dem Angebot teilnehmen kann, sondern die Teilnehmer* entscheiden, ob sie sich diesem pädagogischen Setting zuordnen möchten und können. Wobei das Prinzip der Freiwilligkeit schon immer ein bestimmendes Strukturelement der Jungen*arbeit war und ist.
„Jungen*arbeit unterstützt Jungen* und junge Männer*, ihre emotionale, körperliche, sexuelle und soziale Selbstbestimmung zu leben und wendet sich ebenso gegen soziale, ökonomische, religiöse oder kulturelle Beeinträchtigungen oder Diskriminierungen (…). Emanzipatorische Persönlichkeitsentwicklung, Selbstverantwortung und die reflexive Betrachtung der eigenen Beteiligung an der Konstruktion von Geschlecht und der Geschlechterverhältnisse sind hierfür notwendig“ (Bundesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit e.V., Positionspapier 2016, S.3).
1.2 Rechtliche und fachliche Grundlagen
Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) fordert, dass „(…) bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben (...) die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen, Jungen sowie transidenten, nichtbinären und intergeschlechtlichen jungen Menschen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern“ seien. (vgl. SGB VIII, § 9 Abs. 3)
Im Kinder- und Jugendförderplan des Landes Nordrhein-Westfalen 2018-2022 wird unter Punkt 3 (Grundsätze und Zielgruppen der Förderung) darauf hingewiesen, dass die Angebote der Jugendarbeit „(…) die Gleichstellung von Mädchen und Jungen als durchgängiges Leitprinzip zu beachten [haben] und sollen jungen Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen, sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten gleichberechtigt und mit ihren spezifischen Bedürfnissen und Bedarfen einbeziehen bzw. Angebote entwickeln, die diesen Zielgruppen den Weg in die Angebote der Jugendförderung ebnen“ (vgl. KJFP NRW Punkt 3).
Die geschlechterreflektierende Kinder- und Jugendarbeit wird ebenfalls im kommunalen Kinder- und Jugendförderplan für Bielefeld beschrieben. Hier wird darauf hingewiesen, dass Leitlinien für die Umsetzung geschlechtsdifferenzierter Kinder- und Jugendförderung als Querschnittsaufgabe notwendig sind. (vgl. Kinder- und Jugendförderplan für Bielefeld 2015-2020, S. 10-12, Stadt Bielefeld, 2015) Für die Umsetzung einer geschlechterreflektierenden Kinder- und Jugendförderung ist im Zuge der kommunalen Jugendhilfeplanung die Einbindung und Kooperation mit vorhandenen Arbeitskreisen und Initiativen der Jungen*arbeit zu empfehlen.
-
2. Selbstverständnis der Jungen*arbeit
Die Angebote der Jungen*arbeit sind für alle Kinder und Jugendliche ausgerichtet, die sich als Jungen* angesprochen fühlen. Jungen*arbeit möchte Jungen* befähigen, Antworten auf die Frage zu finden: Wer bin ich oder wie definiere ich mich in Bezug auf mein Geschlecht, ohne dabei Menschen anderer Geschlechter abzuwerten?
Die Aufgabe von Jungen*arbeit besteht darin, mithilfe von geeigneten Maßnahmen und Angeboten, die Entwicklung junger Menschen auf ihrem Weg zum Erwachsensein zu fördern. Da die Sozialisation, Rollenanforderungen und Lebensperspektiven individuell sind, muss die Förderung der Entwicklung darauf abgestimmt sein.
Jungen*arbeit ist eine reflektierende Haltung und keine Methode. Jungen*arbeit ist entsprechend mehr als die Summe angewandter Methoden. Und selbstverständlich ist Jungen*arbeit ein partizipatives und unbedingt auf Freiwilligkeit beruhendes Angebot.
2.1 Die zugeschriebene Geschlechterrolle als zentrale Kategorie Die Geschlechterrolle wird in der Jungen*arbeit als zentrale Kategorie in den Blick genommen. Männlichkeit wird in diesem Sinne nicht als naturhaft gegeben und unveränderlich verstanden, sondern als sozial, gesellschaftlich-historisch konstruiert und in stetiger Entwicklung befindlich. Hier führt besonders die Pluralisierung von Lebenswelten zu einer zunehmend vielfältigen Konstruktion von Geschlecht. Unterschiedliche kulturelle, religiöse und sexuelle Orientierungen stellen dabei eine zusätzliche Anforderung an die Ausgestaltung der Jungen*arbeit dar.
Der Zuweisung von Rollen aufgrund des Geschlechts sind Attribute wie Macht, Herrschaft und Privilegien häufig immanent, die Jungen* als Profiteure erscheinen lassen. Hier ist ein kritischer Umgang mit den positiven und negativen Auswirkungen zu führen.
Ebenso sind Formen von Gewalt im Kontext von Geschlechterverhältnissen aufzuzeigen und zu thematisieren. Ziel soll ein respektvoller und gewaltfreier Umgang sein.
-
3. Ziele der Jungen*arbeit
Ziele des Forum Jungen*arbeit Bielefeld Durch die Teilnahme an Angeboten der Jungen*arbeit verfügen Jungen* über eine geschlechterreflektierende Identität und akzeptieren die Lebensentwürfe Anderer. Jungen* haben erlernt, fortlaufend patriarchale Strukturen zu hinterfragen und tradierte Rollenerwartungen in ihrer Lebenswelt zu erkennen und diese nicht zu reproduzieren. Sie haben ein Selbstbild und Selbstwertgefühl entwickelt, welches nicht auf die Abwertung anderer angewiesen ist. Durch kollegialen Austausch und Fortbildungen im Forum Jungen*arbeit gelingt es, Jungen*arbeiter:innen Räume zu gestalten und Methoden für Jungen* anzubieten. Fachkräfte reflektieren kontinuierlich ihren Arbeitsansatz, ihre Identität und Rolle als Jungen*arbeiter:innen, um den Jungen* eine Orientierung in einer vielfältigen Gesellschaft zu geben.
-
4. Vorgehen in der Jungen*arbeit
Jungen*arbeit ist parteilich, emanzipatorisch, empathisch. Sie stärkt Jungen* und setzt an den Kompetenzen und Potentialen der Jungen* an.
Eine systematische Reflexion der Jungen*arbeiter:innen und des jeweiligen Arbeitsansatzes ist Grundvoraussetzung methodischen Handelns und Basis für die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit. Hier spielt auch die notwendige Selbstreflektion der eigenen Sozialisation und Identität der Jungen*arbeiter:innen eine erhebliche Rolle. Grundvoraussetzung von geschlechterreflektiertem Handeln ist eine Reflektion der erlebten Alltagsabläufe und des eigenen Handelns unter geschlechtsdifferenziertem Blickwinkel.
Jungen*arbeit ermöglicht es, sich in einem geschützten Rahmen in verschiedene Rollen und Handlungsformen ausprobieren zu können.
So ist die Arbeit nur mit Jungen* nicht per se gleich Jungen*arbeit. Erst wenn eine Reflexion männlicher* Geschlechterrollen oder Anforderungen einbezogen wird, kann von Jungen*arbeit gesprochen werden.
4.6 Grenzen setzen, Grenzen erkennen Einen zentralen Aspekt der Jugendarbeit bildet die Auseinandersetzungen mit Jungen um Grenzen: Grenzverletzungen, Übergriffe, sexualisierte Gewalt, sexualisierte Sprache gehören zum Alltag. Jungenarbeiter müssen hier Position beziehen vor dem Hintergrund des eigenen Werteverständnisses von Männlichkeit. Jungenarbeiter können sich nicht auf formale, abstrakte Werte zurückziehen, sondern müssen sich den Auseinandersetzungen mit den Jungen um Grenzen stellen. Die Vermittlung von Grenzen ist für die Jungen nicht nur einschränkend ("Ich darf hier nicht wie RAMBO den Raum dominieren"), sondern auch entlastend ("Ich muss hier gar nicht...") und bietet somit auch einen Schutz und eine Möglichkeit, sich zu öffnen.
-
5. Handlungsperspektiven zur Umsetzung der Rahmenrichtlinien für die Arbeit mit Jungen*
5.1 Konzeptionelle Absicherung von Jungen*arbeit Grundlegende Entwürfe zur Umsetzung von Jungen*arbeit sollen Bestandteile der Konzepte aller Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendfreizeiten und weiterer Einrichtungen der Jugendhilfe sein. Dies ist ebenfalls in den Leistungsverträgen festzuschreiben und zu evaluieren.
Für die Erarbeitung und Weiterentwicklung geschlechterreflektierender, pädagogischer Konzeptionen für die Arbeit mit Jungen* soll den Fachkräften in allen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe ausreichend Zeit eingeräumt werden.
Hierzu sind entsprechende Fortbildungsangebote durch die Kommune zu entwickeln und den pädagogischen Fachkräften trägerübergreifend zugänglich zu machen.
Auf der Verwaltungsebene sind beim öffentlichen Träger der Jugendhilfe entsprechende personelle und organisatorische Voraussetzungen zu schaffen.
Die Vernetzung und Kooperation der Jungen*arbeit mit weiteren pädagogischen Praxisfeldern ist zu fördern.
5.2 Personelle Absicherung Bei Stellenausschreibungen und -besetzungen in den Einrichtungen der Jugendhilfe soll u.a. die fachliche Kompetenz im Bereich der Jungen*arbeit berücksichtigt werden. Jungen*arbeiter:innen soll die Teilnahme an Fachberatungen sowie an Arbeitskreisen zur Jungen*arbeit im Rahmen ihrer Arbeitszeit ermöglicht werden.
5.3 Finanzielle Absicherung Um Maßnahmen der Jungen*arbeit durchzuführen, bedarf es in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zeitlicher, räumlicher und finanzieller Mittel. Zu fördern sind neue Handlungsansätze und innovative Konzepte.
Maßnahmen der Jungen*arbeit sind im Berichtswesen über die Verwendung von öffentlichen Mitteln nachzuweisen. In den Haushaltsansätzen der Einrichtungen sind ausreichende Mittel für Jungen*arbeit vorzusehen.
5.4 Inhaltliche Absicherung der Jungen*arbeit 5.4.1 Jugendhilfeausschuss Der Jugendhilfeausschuss (JHA) verpflichtet sich, das Thema Jungen*arbeit als Querschnittsthema zu behandeln. Die Verwaltung unterrichtet den JHA regelmäßig über den Stand und die Umsetzung dieser Richtlinien. 5.4.2 Jugendhilfeplanung Für eine Bedarfserhebung in der Jungen*arbeit sind Instrumente zu entwickeln und Daten zu erheben, um fehlende Angebote für Jungen* zu eruieren. Um die Planung und Prozesse in der Praxis zu verankern und umzusetzen, trifft der öffentliche Träger mit den freien Trägern der Jugendhilfe adäquate Zielvereinbarungen, z.B. bei Jahresplanungsgesprächen, um die Querschnittsaufgabe bei Bestandsaufnahmen, Planungen und Evaluation in der Praxis zu verankern.
Die Bielefelder Rahmenrichtlinien zur Förderung der Jungen*arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe wurden aktualisiert von Mitwirkenden des Arbeitskreises: Forum Jungen*arbeit Bielefeld.
Stand: August 2023
